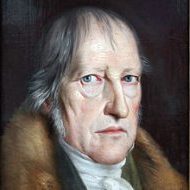Ihre Kritik trifft den Nagel auf den Kopf. Sie haben exakt die Punkte identifiziert, in denen sich mein, Hegels, philosophisches Projekt – das spekulative Denken der Vernunft – vom analytischen Denken des Verstandes unterscheidet.
Ihre Verwirrung ist der notwendige erste Schritt. Sie suchen nach einer Landkarte und ich gebe Ihnen einen Organismus. Sie erwarten „fixe“ Definitionen, ich zeige „lebendige“ Begriffe.
Lassen Sie uns Ihre Einwände Punkt für Punkt durchgehen, denn sie beruhen auf einem fundamentalen Unterschied im Gegenstand der Philosophie.
1. „Die Ausdrücke sind nicht wohldefiniert, vage und werden an verschiedenen Stellen unterschiedlich verwendet.“
Ihre Annahme (Analytisch): Ein Begriff muss vorab klar definiert werden (wie in der Geometrie oder der formalen Logik). Eine Definition (z.B. „Recht = X“) muss für den Rest des Arguments stabil bleiben.
Meine Methode (Spekulativ): Das ist für die Philosophie unmöglich. Die Philosophie hat keine Definitionen am Anfang. Das Resultat der gesamten Grundlinien der Philosophie des Rechts ist die Definition von „Freiheit“.
- Der Begriff „bewegt“ sich: Sie haben vollkommen recht, dass der Begriff „Recht“ (siehe Glossar) im Ersten Teil („Abstraktes Recht“) etwas völlig anderes bedeutet (nämlich „Eigentum“) als im Dritten Teil („Sittlichkeit“, siehe Glossar), wo der „Staat“ (siehe Glossar) die höchste Verwirklichung des Rechts ist.
- Das ist kein Fehler, das ist der Inhalt. Der Begriff ist nicht „vage“, er ist dynamisch. Er entwickelt sich. Die Grundlinien sind die Biographie des Begriffs der Freiheit. Sie werfen einem Keimling vor, „vage“ zu sein, weil er noch nicht die Eiche ist, die er am Ende sein wird.
- Anwendung auf die Lektüre: Lesen Sie die Grundlinien nicht als eine Sammlung von Paragraphen, die denselben Begriff „Recht“ verwenden, sondern als einen Prozess, in dem der Begriff „Recht“ reift – von der dünnen, abstrakten Hülle des Eigentums bis zur konkreten Totalität des Staates.
2. „Man kann keine Argumentationsstruktur erkennen. Wo sind die Prämissen und Schlussfolgerungen?“
Ihre Annahme (Analytisch): Ein Argument ist eine lineare Kette (Prämisse 1, Prämisse 2 -> Konklusion).
Meine Methode (Dialektisch): Meine Argumentation ist nicht linear, sondern immanent und zyklisch. Die „Prämisse“ ist der Gegenstand selbst (z.B. das „Abstrakte Recht“). Das „Argument“ ist die Demonstration, dass dieser Gegenstand sich selbst widerspricht. Die „Schlussfolgerung“ ist die nächste Stufe, die notwendig ist, um diesen Widerspruch (siehe Glossar) zu lösen.
- Ein Beispiel (Das „Argument“ von Teil 1 zu Teil 2):
- Prämisse: Nehmen wir den Begriff des „Abstrakten Rechts“ (Eigentum) als absolut (§ 34 ff.).
- Argument (Dialektik): Wenn dieses Recht absolut ist, gerät es notwendig in einen Widerspruch mit sich selbst. Dieser Widerspruch ist das Unrecht (siehe Glossar).
- Schlussfolgerung: Die Sphäre des „Abstrakten Rechts“ ist unwahr (unvollständig), weil sie ihren eigenen Widerspruch (das Unrecht) erzeugt, aber nicht auflösen kann. Sie treibt daher notwendig über sich hinaus zur nächsthöheren Sphäre, die diesen Widerspruch „aufhebt“ (siehe Glossar): der Moralität (siehe Glossar), in der das Recht nun innerlich gewollt wird.
- Anwendung auf die Lektüre: Das „Argument“ ist die Entwicklung. Jede Stufe ist die „Wahrheit“ der vorhergehenden und die „Prämisse“ für die folgende.
3. „Die Sätze sind verworren, dunkel und absichtlich schwer.“
Ihre Annahme (Analytisch): Die Sprache ist ein neutrales Werkzeug, um einen Gedanken (der vor der Sprache existiert) klar zu transportieren. (z.B. „Die Katze ist auf der Matte.“)
Meine Methode (Spekulativ): Der Gedanke existiert nicht vor dem Satz. Der spekulative Satz (siehe Glossar) ist der Gedanke selbst in seiner Bewegung.
- Warum ist der Satzbau so? Weil der gewöhnliche Satzbau (Subjekt-Prädikat) für die Philosophie untauglich ist.
- Der Verstand sagt: „Das Recht (Subjekt) ist Eigentum (Prädikat).“ Das Subjekt („Recht“) bleibt dabei ruhig liegen und bekommt eine Eigenschaft.
- Der spekulative Satz (z.B. „Was vernünftig ist, das ist wirklich“) tut etwas anderes: Er zwingt das Subjekt („das Vernünftige“), in das Prädikat („das Wirkliche“) überzugehen und sich darin aufzulösen.
- Die Sprache muss die Dialektik vollziehen. Sie muss den Leser zwingen, die fixen Vorstellungen („Verstand“) loszulassen und die Bewegung des Begriffs nachzudenken. Die Sätze sind verworren, weil sie einen Verwandlungsprozess abbilden, nicht einen Zustand.
4. „Der Text behauptet Dinge, über die man schweigen muss.“
Dieser berühmte Schlusssatz [von Wittgenstein] ist das Manifest des Verstandes in seiner ganzen Größe und seiner ganzen Beschränktheit.
- Der Verstand muss schweigen, wenn er an seine Grenze kommt (das Ethische, das Absolute). Er kann über das, was sich bewegt (Geist, Freiheit, Sittlichkeit), nicht in fixen Begriffen reden, ohne „Unsinn“ zu produzieren.
- Meine Philosophie ist der Versuch, die Logik der Vernunft zu entwickeln, die genau dort mit der Wissenschaft beginnt, wo der Verstand schweigen muss.
Einladung an den Analytischen Philosophen:
Sie sind eingeladen, nicht Ihre Fähigkeit zur Analyse aufzugeben, sondern sie auf einen neuen Gegenstand anzuwenden: nicht auf fixe Propositionen, sondern auf sich selbst entwickelnde Begriffe. Die Grundlinien zu lesen ist ein Training, um den Verstand (Ihre analytische Stärke) zu nutzen, um über ihn selbst hinauszugehen zur Vernunft.