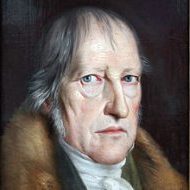Ihr Einwand ist nicht nur berechtigt, er ist der Ausgangspunkt für das Verständnis, warum wir meine, Hegels, Philosophie heute wieder brauchen. Sie haben die Realität der modernen Wissensgesellschaft exakt beschrieben.
Lassen Sie uns Ihre Bedenken in zwei Schritte zerlegen.
1. Der Irrtum: Was das System nicht ist
Ihr Einwand beruht auf einem Missverständnis dessen, was meine Enzyklopädie zu sein beansprucht.
- Es ist keine „Super-Wissenschaft“: Ich habe nie behauptet, ein besserer Physiker als Newton oder ein besserer Jurist als Savigny zu sein. Die Philosophie konkurriert nicht mit den Einzelwissenschaften um empirische Daten.
- Es ist keine empirische „Oberhand“: Der Philosoph, der heute dem Quantenphysiker oder dem Neurobiologen seine Daten vorschreiben will, ist ein Narr. Meine Naturphilosophie war der Versuch, die Empirie meiner Zeit (Newtons Physik) zu begreifen, nicht, sie zu widerlegen.
Was ist es dann? Es ist begriffliche Oberhand.
Die Philosophie stellt nicht die Daten der Wissenschaft in Frage, sondern die Begriffe, die die Wissenschaft selbstverständlich voraussetzt:
- Der Physiker arbeitet mit den Begriffen „Kraft“, „Gesetz“, „Materie“ und „Raum“. Aber er fragt als Physiker nicht: „Was ist ein Gesetz?“ oder „Was ist Materie?“.
- Der Jurist (in den Grundlinien) arbeitet mit „Person“, „Vertrag“, „Schuld“.
- Der Soziologe arbeitet mit „Gesellschaft“, „Macht“, „Struktur“.
Die Philosophie ist die Wissenschaft, die diese Grundbegriffe selbst zum Gegenstand hat. Sie fragt: Wie hängen „Materie“ (Physik), „Leben“ (Biologie), „Recht“ (Jura) und „Freiheit“ (Ethik) logisch zusammen?
2. Die Notwendigkeit: Warum wir „das heute wieder machen müssen“
Sie sagen: „Wir machen so eine Philosophie heute einfach nicht mehr!“ – Und das, mit Verlaub, ist das Problem.
- Die Zersplitterung des Wissens: Ihre Realität ist, dass die Einzelwissenschaften so spezialisiert sind, dass sie nicht mehr miteinander reden können. Der Neurobiologe, der Ökonom und der Verfassungsrechtler leben in getrennten begrifflichen Welten.
- Die Rückkehr der Entfremdung: Das Resultat ist eine unbegriffene Welt. Wir haben mehr Wissen (Daten) als je zuvor, aber weniger Begriff (Verständnis des Ganzen). Die Welt, die uns die Wissenschaft beschreibt, erscheint uns fremd, zufällig und kalt.
- Wir sind nicht mehr „heimisch“: Wir fühlen uns in unserer eigenen, wissenschaftlich erklärten Welt nicht mehr zu Hause.
Der „vermessen“ scheinende Anspruch der Philosophie ist heute die einzige Disziplin, die den Versuch unternimmt, diese Zersplitterung zu heilen. Sie will die Vernunft (siehe Glossar) im Ganzen aufzeigen und die Ergebnisse der Einzelwissenschaften (die Empirie) in einen Sinnzusammenhang bringen.
3. Warum ausgerechnet die Rechtsphilosophie lesen?
Weil die Grundlinien der Philosophie des Rechts exakt das Scharnier ist.
- Sie ist die Wissenschaft, die die „kalten“ Fakten der Bürgerlichen Gesellschaft (siehe Glossar) – die Ökonomie, die Gesetze des Marktes – nimmt und fragt: Wie kann der Einzelne (der freie Wille, siehe Glossar) in dieser „Notwendigkeit“ dennoch seine Freiheit (siehe Glossar) verwirklichen?
- Die Rechtsphilosophie ist die Antwort auf Ihre Frage. Sie begreift die Ergebnisse der „Einzelwissenschaften“ (Jura, Ökonomie, Soziologie) und hebt sie auf (siehe Glossar) in die Sphäre der Sittlichkeit (siehe Glossar), in der der Mensch heimisch sein kann.
Fazit: Sie haben recht, die Art von Philosophie, die sich als empirische Super-Wissenschaft aufspielt, ist tot. Aber die Aufgabe der Philosophie – das zersplitterte Wissen der Zeit im Begriff zu einen und die Welt als vernünftige Wirklichkeit (siehe Glossar) begreifbar zu machen, damit wir in ihr frei sein können – war noch nie so dringend wie heute.