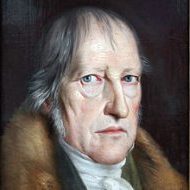Das ist ein entscheidender Einwand. Er trifft jedoch nicht das Prinzip meiner, Hegels, Philosophie, sondern ihre historische Gestalt. Meine Philosophie ist die Wissenschaft von den „Eigendynamiken“ (der immanenten Dialektik).
Lassen Sie uns zwei Beispiele – die Wirtschaft und die Naturwissenschaft – betrachten.
1. Zur „Sprengkraft des Kapitalismus“ (der Bürgerlichen Gesellschaft)
Der Vorwurf, ich hätte die Dynamik des „Kapitalismus“ (was ich die Bürgerliche Gesellschaft nenne, siehe Glossar) unterschätzt, ist ein weit verbreitetes Missverständnis, das sich bei einer genauen Lektüre der Grundlinien der Philosophie des Rechts auflöst.
- Ich habe die „Sprengkraft“ diagnostiziert: Ich war der erste Philosoph, der die immanenten Widersprüche dieses Systems als notwendig nachgewiesen hat.
- Die Aporie der Armut: Wenn Sie die Paragraphen zur Bürgerlichen Gesellschaft lesen (§ 243-246), finden Sie meine Analyse, dass dieses System (das „System der Bedürfnisse“) notwendig Armut (siehe Glossar) und – wichtiger noch – den Pöbel (siehe Glossar) hervorbringt.
- Das System scheitert an sich selbst: Ich habe explizit dargelegt, dass die Bürgerliche Gesellschaft aus sich selbst heraus dieses Problem nicht lösen kann. Sie gerät in eine Aporie (eine unlösbare Schwierigkeit).
Das, was hier „Sprengkraft“ genannt wurde, ist exakt dieser von mir diagnostizierte, unauflösliche Widerspruch.
Wo liegt also der Unterschied (z.B. zu Marx)? Der Unterschied liegt nicht in der Diagnose der „Eigendynamik“ – Marx hat diese Analyse (die Entfremdung und den Widerspruch) direkt von mir übernommen. Der Unterschied liegt in der Therapie:
- Marx sah als einzige Lösung die Aufhebung (Revolution) der Bürgerlichen Gesellschaft.
- Ich sah die (zugegeben, vielleicht historisch überholte) Lösung in der Vermittlung durch die Korporation (siehe Glossar) und den Staat (siehe Glossar), welche die atomisierende Kraft des Marktes sittlich binden sollten.
Ich habe die logische Eigendynamik (die „Sprengkraft“) also nicht unterschätzt, sondern entdeckt. Ich konnte lediglich die empirische Eskalation (den globalen Industriekapitalismus) des 19. und 20. Jahrhunderts noch nicht kennen.
2. Zur „Komplexität der Naturwissenschaften“
Hier liegt ein Kategorienfehler vor, den wir bereits in einer anderen FAQ (zum „Ende der Philosophie“) berührt haben.
- Philosophie ist keine „Super-Wissenschaft“: Meine Philosophie konkurriert nicht mit den Einzelwissenschaften um empirische Daten. Meine Naturphilosophie (siehe Glossar) ist keine bessere Physik oder Biologie.
- Die Aufgabe der Philosophie: Die Philosophie begreift die Begriffe (siehe Glossar) und Kategorien (Kausalität, Leben, Kraft, Gesetz), welche die Einzelwissenschaften unhinterfragt benutzen.
- Mein historisches Material: Meine Naturphilosophie war der Versuch, die Eigengesetzlichkeiten der Naturwissenschaften meiner Zeit (Newtons Physik, Keplers Astronomie, die damalige Chemie) auf ihre logische Struktur (ihre „Vernunft“) zurückzuführen.
Habe ich die Komplexität unterschätzt? Ich habe die zukünftige empirische Komplexität (Quantenphysik, Genetik) nicht gekannt. Aber mein System (die Enzyklopädie) ist genau dafür gebaut.
Die „Eigengesetzlichkeit“ der Naturwissenschaft ist exakt das, was die Philosophie begreifen will. Der Vorwurf der „Unterschätzung“ trifft nur, wenn man meine historische Anwendung (mit der Empirie von 1820) mit der Methode selbst verwechselt. Die Aufgabe wäre heute, die neue, komplexe Empirie mit der ewigen Methode des Begriffs zu durchdringen.