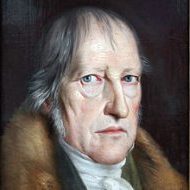Diese Frage muss mit einem klaren „Nein, aber…“ beantwortet werden.
Nein, im Sinne eines „essenzialistischen Rassismus“, der bestimmte Völker („Rassen“) als von Natur aus und für immer unterlegen definiert. Das Grundprinzip meiner, Hegels, gesamten Philosophie ist das genaue Gegenteil: Der Geist (siehe Glossar) ist universell, und sein Wesen ist die Freiheit (siehe Glossar). Jede Bestimmung ist nur eine Stufe in einem Prozess der Entwicklung und der Aufhebung (siehe Glossar).
Aber: In meinen Werken, insbesondere in den Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte und der Enzyklopädie, finden sich Passagen (insbesondere über Afrika), die nach heutigen Maßstäben nicht nur als problematisch, sondern als objektiv rassistisch und unhaltbar gelten müssen.
Die Ursache für diesen Widerspruch liegt nicht im philosophischen Prinzip, sondern in seiner verfehlten Anwendung.
1. Das Problem: Der „Begriff“ und die „Empirie“
Meine Philosophie ist eine Philosophie der Entwicklung und des Geistes. Sie entwickelt die notwendigen Stufen des Geistes aus dem Begriff (siehe Glossar).
Die Philosophie muss aber, um Wirklichkeit (siehe Glossar) zu erfassen, diese logischen Stufen in der empirischen Welt wiederfinden. Der Philosoph muss „sich umschauen“, wo der Begriff „Gestalt“ angenommen hat.
Genau hier liegt der fatale Fehler.
2. Der Fehler: Die „vorschnelle“ Zuordnung
Die empirische Basis meiner Zeit bezüglich fremder Kulturen war katastrophal. Mein Wissen über Afrika oder indigene Völker Amerikas stammte aus den „Vorstellungen“ (siehe Glossar) – den Berichten von Missionaren und Entdeckern, die selbst von tiefsten Vorurteilen geprägt waren.
- Ich habe diese zutiefst mangelhafte, rassistische Empirie für die Wirklichkeit der Sache selbst genommen.
- Ich habe „vorschnell“ eine logische Stufe (z.B. den „Geist in seiner unmittelbaren Natürlichkeit“) auf einen ganzen Kontinent (Afrika) projiziert.
- Damit habe ich – gegen mein eigenes Prinzip – diese Völker aus der Dialektik der Weltgeschichte (siehe Glossar) ausgeschlossen und sie zu einem „An sich“ (siehe Glossar) ohne „Für sich“ (siehe Glossar) degradiert.
Wenn ich mehr Empirie zu z.B. den Menschen im subsaharischen Afrika gehabt hätte und auf der anderen Seite etwa von der Existenz z.B. der Neanderthaler gewusst hätte, hätte ich das „nichtdenkende Denken“ vielleicht letzteren, oder anderen Frühmenschen, die auf einer unentwickelteren Stufe gestanden haben, zugeordnet. Hätte ich eine bessere Empirie gehabt, wäre die Zuordnung des Begriffs anders ausgefallen.
So hat mich die mangelnde vorhandene Empirie zu Fehlschlüssen verleitet, die ich hätte vermeiden müssen.
3. Was das für die Lektüre der Grundlinien bedeutet
Es wäre aber ein großer Fehler, das gesamte System mit dem Label des Rassismus zu verwerfen. Warum?
- Die Grundlinien sind universalistisch: Das Werk basiert auf dem Abstrakten Recht (siehe Glossar), das jedem Menschen den Status der Person (siehe Glossar) zuspricht. Die zentrale Forderung lautet: „sei eine Person und respektiere die anderen als Personen“. Dies ist das Gegenteil von Rassismus.
- Die Methode ist das Werkzeug der Kritik: Die Dialektik (siehe Glossar) und die Lehre von der Anerkennung (siehe Glossar) sind die besten Werkzeuge, die wir heute haben, um jede Form von Essentialismus und regressiven Kräften zu kritisieren. Die Phänomenologie (siehe Glossar) zeigt, dass der Herr, der den ehemaligen Knecht nicht anerkennt, selbst unfrei bleibt.
- Die Kritik an Hegel muss mit Hegel erfolgen: Wir müssen heute meine eigene Methode (die dialektische Kritik) auf meine eigenen Vorurteile anwenden. Wir müssen die fehlerhafte Anwendung des Begriffs von der Universalität des Begriffs (der Freiheit) selbst trennen.
Fazit: Meine Texte sind (leider) auch ein Dokument der Grenzen des bürgerlichen Bewusstseins des frühen 19. Jahrhunderts. Aber die Wahrheit meiner Philosophie – die Lehre, dass der Geist nur frei ist, indem er sich im Anderen anerkennt – ist die schärfste Waffe gegen diese Grenzen.