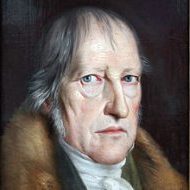„Das Seyn war das Erste, Daseyn, Seyn für Andres , Seyn mit Negation war das zweite. Das dritte Fürsichseyn, einfache Beziehung auf sich durch Negation des Andern, des Daseyns[.] Wir haben hier Idealität, im Daseyn Realität; Idealität ist, daß das Endliche nur gesetzt ist als aufgehoben, die Idealität ist nichts Andres als dieses, daß alles Endliche kein wahrhaftes Seyn hat, sondern daß Seyn ein Aufgehobenes ist, ein negatives. Das Seyn ist nur Moment von einem, das Wahrheit ist. Idealität nimmt man dann im Sinne des subjektiven Idealismus, daß Alles nur meine Vorstellung ist, darin ist die eigne Selbstständigkeit der Dinge aufgehoben, indem ich die Dinge weiß, so sind sie aufgehoben; das ist diese formelle Idealität; der subjektive Idealismus ist triviale Abstraktion denn es kommt auf Inhalt an , wie er beschaffen ist, ich bin darin auch ein sehr Endliches, mein Vorstellen hat keine wahrhafte Realität; im Begreifen ist meine Subjektivität selbst überwunden, denn wenn ich etwas begreife , so bin ich in der Sache. Jede wahrhafte Philosophie ist Idealismus d. h. Idealität des Endlichen.“ (Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik II, GW 23,2, S. 737)
„Der Satz, daß das Endliche ideell ist, macht den Idealismus aus. Der Idealismus der Philosophie besteht in nichts anderem als darin, das Endliche nicht als ein wahrhaft Seiendes anzuerkennen. Jede Philosophie ist wesentlich Idealismus oder hat denselben wenigstens zu ihrem Prinzip“ (Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832), GW 21, S. 142).
Im alltäglichen Sprachgebrauch hat „Idealismus“ zwei falsche Bedeutungen: Entweder meint man (moralisch) jemanden, der „hohen Idealen“ folgt, oder man meint (abwertend) jemanden, der „die Realität“ leugnet.
Mein (Hegels) philosophischer Idealismus hat mit beidem nichts zu tun.
Die Kernaussage meines Idealismus ist, wie oben richtig zitiert:
„Der Satz, daß das Endliche ideell ist, macht den Idealismus aus.“
Um das zu verstehen, müssen wir zwei Begriffe klären: „das Endliche“ und „ideell“.
1. Was ist „das Endliche“?
„Das Endliche“ ist alles, was uns in der Welt begegnet, wenn wir es isoliert betrachten.
- Ein Stuhl, ein Stein, ein Planet.
- Ein einzelner Gedanke, ein Gefühl, eine Laune.
- Eine einzelne Person, ein einzelnes Gesetz, ein isoliertes Ereignis.
All diese Dinge existieren, aber sie sind „endlich“. Das heißt: Sie sind nicht aus sich selbst heraus. Sie sind abhängig, begrenzt und unvollständig. Sie haben ihre Ursache und ihren Sinn nicht in sich selbst.
2. Was ist „ideell“?
„Ideell“ ist das Gegenteil von „selbstständig real“.
Wenn ich sage: „Das Endliche ist ideell“, meine ich: Diese isolierten, endlichen Dinge (der Stuhl, der Gedanke, das Gesetz) haben kein wahrhaftes Sein (siehe oben).
Ihre „Wahrheit“ oder ihre „Wirklichkeit“ liegt nicht in ihrer Isolation. Sie sind „aufgehoben“.
„Aufgehoben“ (siehe Glossar) bedeutet: Sie sind nur ein „Moment“ (ein unselbstständiger, aber notwendiger Teil) von einem Größeren, einem Ganzen, das allein wahrhaft real ist.
Eine Analogie: Betrachten Sie einen einzelnen Pinselstrich in Rembrandts „Nachtwache“.
- Dieser Pinselstrich ist „das Endliche“. Er existiert.
- Aber ist er wahrhaft seiend? Nein. Seine ganze Wahrheit, sein Sinn und seine Realität bestehen nur als Moment des gesamten Gemäldes.
- Isoliert man den Pinselstrich (schneidet ihn aus), verliert er seinen Sinn und seine „Wirklichkeit“. Er ist ideell.
Analogie 2: Der „ideelle Wert“: Ein anderes, alltägliches Beispiel, das diesen meinen Sprachgebrauch plausibilisiert, ist der „ideelle Wert“ eines Gegenstandes – im Gegensatz zu seinem bloßen „materiellen Wert“.
Denken Sie an einen alten, abgenutzten Ehering.
- Sein „materieller Wert“ (das Gold) ist „endlich“ – isoliert betrachtet ist er fast wertlos (a).
- Sein „ideeller Wert“ (die Erinnerung, die Ehe) ist jedoch unermesslich (b).
Was wir hier „ideell“ nennen, ist exakt das, was ich meine: Der Ring hat sein „wahres Sein“ nicht in sich als endliches Ding, sondern nur als Moment (als unselbstständiger Träger) eines Ganzen – der gelebten Beziehung (der Idee). Sein ‚reales‘ Sein als Ding ist aufgehoben in seiner ‚ideellen‘ Bedeutung.
Das „Ding aus Metall“ (a) ist, obwohl es real existiert, in Wahrheit „ideell“. Man würde sagen: Der Ehering (als bloßes Ding aus Metall) ist ideell. Damit meint man: Seine Realität (a) ist aufgehoben (siehe Glossar) in seiner Wahrheit (b). Er hat sein wahres Sein nicht in seiner endlichen Existenz als Metall, sondern nur in seiner Bedeutung für das Ganze der Ehe.
3. Was Idealismus nicht ist (Das häufigste Missverständnis)
Wie es sich auch aus dem obigen Zitat (aus der Logik-Vorlesung) zeigt, verwechsle ich meinen Idealismus (den Absoluten Idealismus) niemals mit dem Subjektiven Idealismus.
- Subjektiver Idealismus ist die (wie ich finde, triviale) Ansicht, dass „Alles nur meine Vorstellung ist“ – dass die Welt „in meinem Kopf“ ist.
- Dagegen halte ich: Mein „Ich“, mein subjektives Vorstellen, ist genauso endlich wie der Stuhl, den ich vorstelle. Auch mein „Ich“ ist nur ein „Moment“ des Ganzen.
4. Was ist Absoluter Idealismus?
Der Absolute Idealismus ist die Einsicht, dass das einzige, was „wahrhaft seiend“ (nicht-endlich, nicht-ideell) ist, das Ganze selbst ist: die Vernunft, der Begriff, die Idee oder der Geist.
Es ist die Position, dass die logische Struktur der Vernunft und die Tiefenstruktur der Wirklichkeit identisch sind.
Für Ihre Grundlinien-Lektüre bedeutet das:
- Das Abstrakte Recht (Eigentum) ist „endlich“. Es ist „ideell“.
- Die Moralität (das Gewissen) ist „endlich“. Sie ist „ideell“.
- Sie sind „wahrhaft seiend“ nur als aufgehobene Momente in der Sittlichkeit (Familie, Gesellschaft, Staat), welche die konkrete Idee der Freiheit ist.